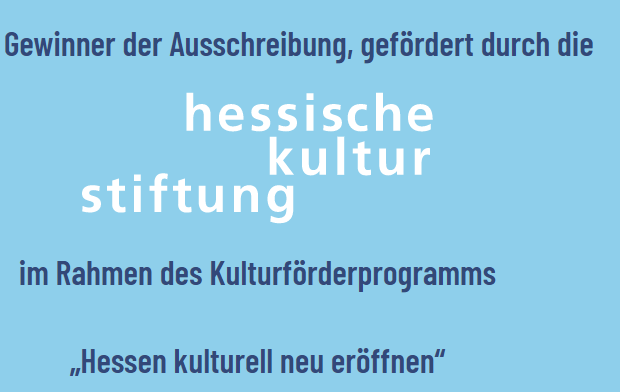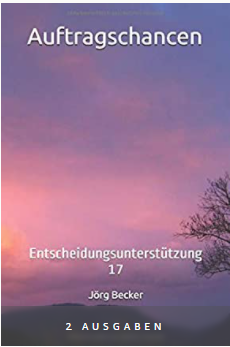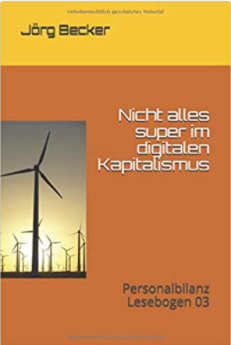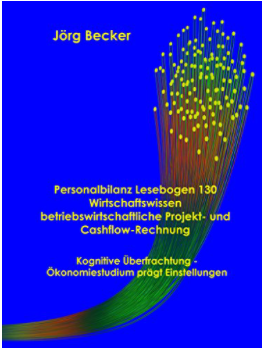Die Aufklärung hat den Hofnarren abgeschafft, in der Annahme, ihre Kritik von einem neutralen, unangreifbaren Standpunkt zu formulieren. „Kritiker“ ist keine eingetragene Berufsbezeichnung, in der öffentlichen Wahrnehmung aber meist an bestimmte Statusgruppen gebunden, etwa Künstler, Schriftsteller, Publizisten u.a. Von einem Kritiker wird erwartet, dass er zunächst seine Standort nennt, von dem aus der spricht, seine eigene Befangenheit vorzeigen und seine Worte entsprechend temperieren sollte.

Mit effizienten Lernkulturen Wissen fördern: insbesondere geht es darum, überkommene Hierarchien ab- und dafür eine effiziente Lernkultur aufzubauen. Potentielle Stärken lassen sich gezielter entwickeln, indem das vorhandene Wissen und die Ideen schneller und effizienter in die tägliche Praxis umgesetzt werden.
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
J. Becker Denkstudio - gesellschaftliche Auswirkungen der KI

Wettbewerbsdruck & Monopolisierung
Unternehmen mit Zugang zu großen Datenmengen haben einen enormen Wettbewerbsvorteil.
KI-getriebene Unternehmen könnten kleinere Marktteilnehmer verdrängen.
Staaten investieren in KI, um technologische Unabhängigkeit zu sichern (z. B. China, USA, EU).
Soziale Ungleichheit & Wohlstandsverteilung
KI kann Wohlstand schaffen, aber auch bestehende Ungleichheiten verschärfen.
Hochqualifizierte Arbeitskräfte profitieren, während einfache Tätigkeiten wegfallen.
Ohne gezielte Maßnahmen droht eine "digitale Kluft" zwischen technologisch führenden und abgehängten Regionen.
Einfluss auf Meinungsbildung & Demokratie
KI-Algorithmen steuern, welche Inhalte Menschen in sozialen Medien sehen (Filterblasen, Fake News).
Manipulation durch Deepfakes oder KI-generierte Propaganda gefährdet demokratische Prozesse.
Gleichzeitig könnte KI helfen, Falschinformationen zu erkennen und zu bekämpfen.
https://buchshop.bod.de/kreativwirtschaft-und-wirtschaftsstandort-im-ki-gespraech-joerg-becker-9783769317862
Denkstudio-Coaching Management Creativity
UMWELT-, KOMPETENZ- UND
WISSENSCOACHING
Intellektuelles Kapital ist Trumpf
https://www.bod.de/buchshop/umwelt-kompetenz-und-wissenscoaching-joerg-becker-9783756898473
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
BUSINESS COACHING –
Decision Support mit Ansage
https://www.bod.de/buchshop/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
Blog Führungskräfte Coaching - Wissensmanagement ist Chefsache
BLOG FÜHRUNGSKRÄFTE COACHING – WISSENSMANAGEMENT IST CHEFSACHE
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
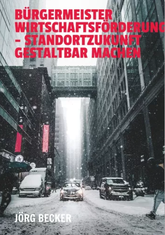
Bürgermeister Wirtschaftsförderung
Standortzukunft gestaltbar machen
Inspirierende KI-Gespräche
Praxisnah und zukunftsorientiert
Das Buch zeigt Bürgermeistern, Kommunalpolitikern und Wirtschaftsförderern konkrete Wege, wie sie ihren Standort aktiv gestalten können – mit neuen Technologien, KI und innovativen Strategien.
Inspirierende KI-Gespräche als Denkanstoß
Durch fiktive oder reale Gespräche mit einer KI werden neue Perspektiven aufgezeigt, die über klassische Wirtschaftsförderung hinausgehen.
Digitalisierung und KI verständlich erklärt
Gerade für Entscheidungsträger ohne technischen Hintergrund wird verständlich, welche Chancen KI für Wirtschaft, Verwaltung und Standortentwicklung bietet.
Konkurrenzfähigkeit von Städten und Gemeinden stärken
Angesichts von Globalisierung, demografischem Wandel und Fachkräftemangel hilft das Buch, den Standort mit zukunftsweisenden Konzepten wettbewerbsfähig zu halten.
Konkrete Handlungsempfehlungen
Neben Inspirationen gibt es auch pragmatische Ansätze für Förderprogramme, Start-up-Ökosysteme und digitale Infrastruktur.
Wirtschaftswissen der „stupid german money“ – eine Gefahr für riesige Schuldenberge?

Was an wirtschaftlicher Allgemeinbildung schon bei Schülern versäumt wurde, setzt sich dann nahtlos später auch bei Studenten und letztlich innerhalb der gesamten Bevölkerung fort. Selbst ein kleines Wirtschafts-Einmaleins: etwa das Abwägen von Kosten und Nutzen, die Unterscheidung zwischen realen und nominalen Größen, absoluten und relativen Werten, Brutto und Netto ist den meisten Menschen fremd.
https://buchshop.bod.de/fuehrungskraefte-coaching-wirtschaftsmathematik-joerg-becker-9783758371646
#Bildung #Wissen – Inspiration der #Geldanlage im KI-Gespräch – SMART: Ziele sollen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein
Lebenslanges #Lernen
#Bildung, #Wirtschaft, #Zukunft im #KI-Dialogmodus
https://buchshop.bod.de/bildung-wissen-lebenslanges-lernen-joerg-becker-9783819225321

Die Aussage, dass man besser sei als andere, wäre zunächst nur eine Behauptung ohne Wert, solange sie nicht konkret, d.h. immer auch mit nachvollziehbaren Bewertungen, belegt Die Aussage, dass man besser sei als andere, wäre zunächst nur eine Behauptung ohne Wert, solange sie nicht konkret, d.h. immer auch mit nachvollziehbaren Bewertungen, belegt werden kann.
werden kann.
Wer „hard facts“ beeinflussen will, muss sich hierfür oft mit „soft facts“ befassen, d.h. beispielsweise:
welche Kommunikations-, Kooperations- und Entscheidungsmuster prägen die Unternehmenskultur?
welche Vorstellungen gibt es, wie Veränderungen funktionieren?
welche Denk- und Verhaltensmuster sind hinderlich für den Erfolg?
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=6&q=J%C3%B6rg+Becker
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
J. Becker Denkstudio - Team Player
Früher stand am Anfang von Unternehmen meist eine Erfindung, ein mühsam entwickeltes Produkt. In der Old Economy vergrub sich ein werdender Unternehmer mit einem Traum oder einer Idee in einer Werkstatt oder in einem Labor, bis er nach langen Zeiten des Experimentierens dann endlich mit einem Produkt an die Öffentlichkeit trat. Heute dagegen starten manche Gründer quasi in Serie einen Online-Marktplatz nach dem anderen.

In regelmäßigen Abständen werden von Jörg Becker zum Themenbereich Standortanalyse Whitepaper verfasst
Nach dem humboldtschen Bildungsideal soll ein autonomes Individuum eine Person sein, die Selbstbestimmung und Mündigkeit durch ihren Vernunftgebrauch erlangt.
Das Ideal nach dem Konzept von Business Intelligence ist die Gewinnung von Erkenntnissen, die im Hinblick auf bestimmte Ziele bestmögliche operative und strategische Entscheidungen ermöglicht und unterstützt.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
J. Becker Denkstudio
direkt zum Beruf:
https://www.rheinmaingeschichten.de/beruf/
direkt zur Akquisition:
https://www.derstandortbeobachter.de/akquisition
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Man steckt meist selbst in Netzwerken fest, was auch die gegenseitige Kritik zum Verstummen bringt. Kritiker sprechen über die „Ohnmacht des Arguments gegenüber Netzwerkeffekten, über die Verlagerung von Verantwortung in unerreichbare Rechtsregime.“ Im „Schweigen der Vernetzungsjunkies“ versinkt „jeder Anflug von Konkretion in lähmender Selbstreflexion“.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
Die besten Analysen verlieren an Wert, wenn ihre Aussagen im Unternehmen nicht verbreitet und umgesetzt werden können.
So wie damals die Dampfmaschine das Ausüben von Arbeitskraft verstärkt hat, so erweitert heute der Computer die Möglichkeiten, Wissen aufzufinden. Das Starten einer digitalen Suchmaschine zur Erschließung von Wissen im Internet geht schneller und leichter als die Befragung eines Experten. Die Welt wird quasi am Bildschirm lesbar, das Wirkliche zum Bestand gemacht. Die Automatisierung von Expertenwissen bringt in einer informationsüberfluteten Gesellschaft Vorteile.
Aber so wenig, wie Menschen vollständig von Dampfmaschinen abgelöst wurden, so wenig wird man auch trotz Internet auf Experten verzichten können.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Quantifizierendes Denken steht so sehr im Vordergrund, dass manchmal qualifizierende und erfahrungsorientierte Analysen kaum mehr durchzudringen vermögen. Die Digitalisierung auf der technologisch-ökonomischen Ebene (Informationsfluss in Echtzeit über jeden Raum hinweg) kreiert ein Paradigma der Machbarkeit.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz