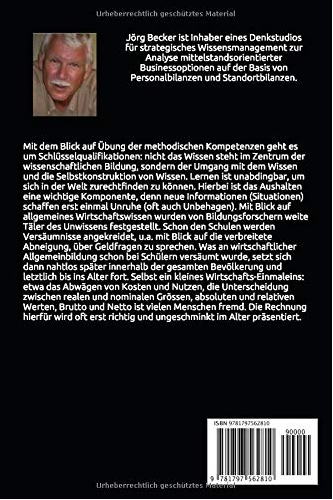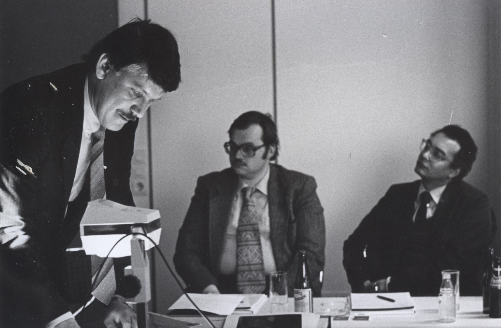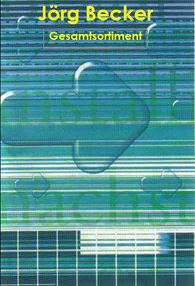Das Entscheidungsumfeld ist laufenden Veränderungen unterworfen: durch die Globalisierung erweiterte Wirtschaftsräume, durch das Internet neue Interaktions- und Veränderungsdynamiken. Keine Einzelperson verfügt über genug Wissen, um sämtliche Möglichkeiten einer solchen ungeheuren Komplexität noch sicher verstehen und kontrollieren zu können. Wer aber das umgebende Geschehen nicht mehr vollständig erfassen kann, muss Wissenslücken, Zielkonflikte und Kontrollverluste in Kauf nehmen.
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
J. Becker Denkstudio - Veränderungen im Leseverhalten

Nachfrage nach prägnanten, KI-optimierten Inhalten
Leser erwarten zunehmend komprimierte, direkt nutzbare Informationen (z. B. KI-generierte Zusammenfassungen).
KI könnte Sachbücher automatisch in kürzere Artikel oder Podcasts umwandeln.
Interaktive & multimodale Formate
KI könnte Sachbücher in interaktive, personalisierte Lernformate transformieren.
Zukünftige Bücher könnten KI-Chatbots enthalten, die mit den Lesern in Echtzeit interagieren.
Evolution statt Revolution
KI wird den Sachbuchmarkt nicht zerstören, sondern ihn transformieren:
Autoren können KI als kreativen Assistenten nutzen.
Leser profitieren von personalisierten Inhalten und neuen Formaten.
Qualität und Originalität werden noch wichtiger, um sich gegen KI-generierte Masseinhalte abzugrenzen.
https://buchshop.bod.de/kreativwirtschaft-und-wirtschaftsstandort-im-ki-gespraech-joerg-becker-9783769317862

Immer schön positiv denken verhilft auch nicht jedem zum Erfolg: Indem man bereits als erreicht vorwegnimmt, was erst noch durch Arbeit erreicht werden muss, kann die Motivation zur Verfolgung des Ziels gelähmt werden. Phantasieerfolge können dazu verführen, die erwünschte Zukunft schon zu genießen, statt den Erfolg (durch mühsames Planen) tatsächlich zu erarbeiten.
BUSINESS COACHING –
Decision Support mit Ansage
https://www.bod.de/buchshop/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für
strategisches Wissensmanagement
Entscheidungskompetenzen sollten dorthin verlegt werden, wo die Dinge geschehen
https://www.bod.de/buchshop/startup-im-datenozean-joerg-becker-9783739229263
Zwar können Computerprogramme Quizfragen beantworten oder medizinische Diagnosen erstellen. Aber was ist mit einer weiterer Domäne des Menschen: der Kreativität? Ist Kreativität so etwas wie ein Etikett, das man auf kognitive Prozesse klebt, solange man sie nicht versteht?
Blog Führungskräfte Coaching - Wissensmanagement ist Chefsache
BLOG FÜHRUNGSKRÄFTE COACHING – WISSENSMANAGEMENT IST CHEFSACHE
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Man braucht eine neue Perspektive, so etwas wie einen "synthetischen" Blick des ganzheitlichen Denkens
Lohnt sich immer das Wagnis des Neuen, oder sollte man manchmal doch lieber auf Bewährtes setzen? Entscheidungsunterstützung bietet die Lindy-Regel: je länger ein System oder Prinzip bereits existiert und funktioniert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in Zukunft noch existieren und funktionieren wird.
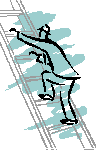
Personalbezogene Fragestellungen sollten bereits bei der Strategieentwicklung berücksichtigt werden und nicht erst, wenn das Personal mit seinen Qualifikationen, Fähigkeiten, Kompetenzen zum Engpassfaktor wird. Da Intellektuelles Kapital nicht beliebig und meist auch nicht kurzfristig an die gewünschte Strategie anpassbar ist, gilt es, von Beginn an die Ressource "Personal" zu entwickeln, um dann darauf aufbauend, überhaupt erst anspruchsvolle Strategien entwickeln zu können.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=24&q=J%C3%B6rg+Becker
Niemand weiß, welche Instanz an den Reglern der Algorithmen sitzt, man kennt weder Motiv noch hat man Einfluss auf sie
https://www.amazon.de/Zeitspr%C3%BCnge-J%C3%B6rg-Becker/dp/B084Z4Z752
Erfolg einer Karriere hängt von vielem ab
Karrieren, die nur auf Glück und Zufall beruhen, sind eher selten. Denn ohne Intelligenz, Wissen und Einsatz kommt auch keine Karriere zustande (von nichts kommt nichts). Es braucht also Leistung. Doch nicht alle, die etwas leisten, schaffen eine erfolgreiche Karriere. Es muss also darüber hinaus Einflussfaktoren geben, die den Unterschied ausmachen. „Dass wir ein Leben lang hat für unsere Ziele gearbeitet haben – von der Schule über die Universität bis hin zur Mid-Career-Weiterbildung an der Business School – das vergessen wir nicht…die kleinen Zufälle aber, die womöglich die Karriere entschieden haben, blenden wir aus“.
Vermutete Wirkungszusammenhänge
Die Welt, wie sie sein wird, vermag man selbst mit noch so hochkomplexen Klimamodellen nicht abzubilden. Vermutete Wirkungszusammenhänge müssen radikal vereinfacht werden, um sie einigermaßen realitätsnah darstellen zu können. Big Data macht zwar fast alles irgendwie rechenbar aber deswegen den Lauf der Dinge noch längst nicht (und schon gar nicht genau) vorhersagbar, „Auch im Informationszeitalter bleibt es eine Kunst, die Zeichen der Zeit zu lesen“.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=19&q=J%C3%B6rg+Becker
Abi63 Schaukasten Nr. 11
J. Becker Denkstudio – Wandel der Bildungsbiographien

Vor der Jahrtausendwende, beispielsweise in den 60er Jahren, sah manche Bildungsbiographie in etwa so oder ähnlich aus:
mit 6 Jahren eingeschult
mit 10 Jahren Aufnahme in die Sexta eines Gymnasiums
mit 19 oder 20 Jahren (bei evtl. einer Ehrenrunde) Abitur
mit 22 Jahren Ableistung des Wehrdienstes und dann Beginn eines Studiums
nach etwa 12 Semestern, d.h. mit 28 Jahren Erwerb eines Diploms
nach weiteren 2 Jahren Aufbaustudium, Orientierung oder Studium Generale mit 30 Jahren Einstieg in den Beruf
Aus der Sicht heutiger Bildungsökonomen wäre solches eher einem lange andauernden Horrorszenario zuzurechnen
Das heutige Ideal wird hiervon abweichend eher so definiert:
mit 5 Jahren eigeschult
nach nur acht Jahren auf dem Gymnasium
mit etwa 17 Jahren Zeugnis der Reife (obwohl weder volljährig noch unterschriftsberechtigt) als G8-Studierender auf die Universität und mit 23 Jahren Studienabschluss und Start der Karriere
J. #Becker #Denkstudio - #Wirtschaft #Mittelstand:
#Kreativwirtschaft und #Wirtschaftsstandort im KI-Gespräch – #Analysen, #Fallbeispiele, #Handlungsempfehlungen
#Gründen im KI-Gespräch – Skizzen einer #Innovationsgesellschaft
https://buchshop.bod.de/gruenden-im-ki-gespraech-joerg-becker-9783769304039

In regelmässigen Abständen werden von Jörg Becker zu Themen "Personalentwicklung" und "Standortanalyse" Whitepaper verfasst
J. Becker Denkstudio - Börsenanalysen sind Abbilder von Gefühlswelten
Geldspiele sind ein Weg, herauszufinden, wer man eigentlich ist. Ein Weg, der manchmal sehr kostspielig sein kann. Für den, der nicht weiß, wer er wirklich ist, für den ist die Börse oft ein teurer Ort. Man muss imstande sein, mit jeder Situation fertig zu werden, ohne seine Gelassenheit zu verlieren oder sich von Gefühlen überwältigen zu lassen. Man muss ohne innere Unsicherheit handeln.
Geldspiele basieren auf einer Reihe von grundlegenden Wahrheiten und Regeln, Die große Unbekannte ist die weite Welt der Emotionen. Diagramme und Charts sind eigentlich immer nur Abbilder von Gefühlswelten. Die zahlreichen Aktienanalytiker wollen eigentlich immer nur recht haben, ihr Ego braucht die Droge, recht zu haben. Manchmal ist es ihnen fast lieber, recht zu behalten, als Geld zu verdienen. Um nicht unterzugehen, müssen sie am Ende aber öfters recht als unrecht haben.
J. #Becker #Denkstudio - #Bildung #Wissen
#Führungskräfte #Coaching #Wirtschaftsmathematik – #Strategische #Kompetenz
https://buchshop.bod.de/fuehrungskraefte-coaching-wirtschaftsmathematik-joerg-becker-9783758371646
#Bildung #Wissen – Inspiration der #Geldanlage im KI-Gespräch – SMART: Ziele sollen spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein
Ökonomen müssen reagieren
Niemand ist eine Insel, auch nicht die Betriebswirtschaft. Sie muss reagieren, und dies zeitnah mit einer ökologischen Erfolgsmessung. Um alles dies realitätsgerecht abbilden zu können, müssen betriebswirtschaftliche Instrumente hinterfragt und neu ausgerichtet werden.
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:
Immer mehr Daten sammeln ist schön und gut: nur nutzt es wenig, wenn mit den Daten nichts passiert. Ob nun Geschäftsdaten, Kundendaten, Inhalte aus dem Web, Kommunikation zwischen Maschinen oder soziale Netzwerke: über allem steht stets die richtige Frage: d.h. wer in großen Datenbergen gute Antworten finden will, braucht gute Fragen. Man kann heute zwar über bessere Software und Methoden verfügen, die Daten zu analysieren: doch auch gesteigerte Rechenleistungen entbinden nicht vom effektiven Informationsmanagement und der Kernfrage: was soll mit welchen klar umrissenen Zielen analysiert werden? Einerseits sitzt man mit jenen angesammelten Datenbergen auf einem Wissensschatz, hat aber andererseits manchmal eher nur unklare Vorstellungen darüber, wie dieses schwer durchschaubare Geflecht eigentlich zu heben und auszuschöpfen wäre.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio - Schaukasten Nr. 14 - Expertise
Wissensmanagement: Gute Antworten brauchen gute Fragen
Immer mehr Daten sammeln ist schön und gut: nur nutzt es wenig, wenn mit den Daten nichts passiert. Über allem steht stets die richtige Frage: d.h. wer in großen Datenbergen gute Antworten finden will, braucht gute Fragen.
Für seine Ideen muss man nach Verbündeten suchen: schon ein einziger könnte dafür sorgen, dass eine Idee sehr viel wahrscheinlicher umgesetzt wird. Viele geben auf, weil sie Angst haben, sich lächerlich zu machen oder Zeit zu verschwenden. Aber in der langen Sicht bedauern wird nicht das, was wir getan haben, sondern das, was wir nicht getan haben. Wir brauchen weniger Konformisten, denn Konformismus ist oft schädlich. Er besagt: Ich stimme dir nicht zu, werde dir aber folgen, weil ich Angst habe, meine Meinung zu sagen. Das aber wäre sehr, sehr schlecht.
Mittelstand mit ganzheitlichem Strategiedenken und wertorientierter Erfolgsplanung
J. Becker Denkstudio - Schaukasten Nr. 16 - Filterblase
Eigendynamik einer Situation bedeutet, dass sich die Dinge auch ohne steuernde Eingriffe von außen selbständig entwickeln können und nicht unbedingt von einem Problemlöser oder Entscheider abhängen. Dadurch bedingt ist eine nur begrenzte Verwertbarkeit von Handlungskonzepten. D.h. auch in der Vergangenheit bewährte Konzepte können nur bedingt auf eigendynamische Situationen übertragen werden. Eine Situation ist undurchsichtig, wenn die ihr innewohnenden Entscheidungs-variablen und Einflussfaktoren nur unscharf sichtbar gemacht und zugeordnet werden können.
direkt zur Region:
https://www.rheinmaingeschichten.de/
direkt zum Regionalmarketing:
https://www.derstandortbeobachter.de/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz