
J. Becker Denkstudio – Selfpublishing in KI-Zeiten

Publikationsliste und Buchtitel
Autorenprofil
Unter anderem detailliert bei Amazon:
https://www.amazon.de/stores/author/B0045AV5YQ/about
Vertriebswege:
Unter anderem Onlineshops wie Amazon, Thalia, Hugendubel
Marktsegment Wirtschaft Mittelstand, Kreative, Startups
2024:
Gründen im KI-Gespräch
Suche der besten Gesundheit-REHA im KI-Gespräch
Führungskompetenz Handlungsorientierung mit KI-Dialogen
Quantitäten und Qualitäten einer Wirtschaftsanalyse mit KI
Karrierecoaching – Booster für Bewerbungen
Manager Coaching einer REHA-Auszeit
Karrierecoaching – wie attraktiv ist die Beraterwelt
Strategie im KI-Zeitalter
Kreativwirtschaft und Wirtschaftsstandort im KI-Gespräch
Business Coaching
2025:
Marktsegment Bildung Wissen - Führungskräfte, Karriere, Geldanlage
2024:
Technik und Menschsein mit KI
Berufserfolg und Bildungsintelligenz mit KI
Wissensmanagement im KI-Dialogmodus
Lehrer Coaching – Schulfach Praxis Wirtschaftsrechnen
Karrierecoaching – das wertvollste Kapital ist Wissen
Führungskräfte Coaching Wirtschaftsmathematik
Karriere Coaching – es wird ein neues Spiel gespielt
Coaching Szenen eines agilen Übergangs
Personal „Kopfschätze“ Coaching
2025:
Bildung Wissen – Inspiration der Geldanlage im KI-Gespräch
Bildung Wissen – Lebenslanges Lernen. Wirtschaft-Wohlstand-Kultur-Zukunft
Marktsegment Bürgermeister, Wirtschaftsförderung
2024:
Bürgermeister Coaching – ein ständiges Fließen von Umgestaltung
Bürgermeister Coaching Leadership Wirtschaftsförderung
Umwelt-, Kompetenz- und Wissenscoaching
Managementcoaching Standortwissen
Coaching Wirtschaftsförderung XXL
2025:
Bürgermeister Wirtschaftsförderung – Standortzukunft gestaltbar machen
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
BLOG FÜHRUNGSKRÄFTE COACHING – WISSENSMANAGEMENT IST CHEFSACHE
https://www.beckinfo.de/blog-f%C3%BChrungskr%C3%A4fte-coaching-wissensmanagement-ist-chefsache/
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Ein Zuviel an Informationsmenge suggeriert leicht eine Sicherheit, die es so gar nicht gibt, nicht geben kann. Es ist eine wichtige Fähigkeit, mit Unterstützung von Business Intelligence- und Wissensbilanzkonzepten verwerfen und gewichten zu können und auch mit der Mehrdeutigkeit von Informationen leben zu können, die sich nicht sofort und genau 1:1 einordnen lassen.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
In Märkten mit evolutionären Ausleseprozessen hat Flexibilität Priorität: wer nicht auf der Höhe der Zeit ist, fällt dem „Digitalen Darwinismus“ zum Opfer. Nicht immer die Stärksten und Größten überleben, sondern eher die Agilsten. Agilität steht für Gewandtheit und Beweglichkeit. Konkrete Erfolgsfaktoren sich hierbei: Risiken wagen, schnell entscheiden und aus Fehlern lernen.
Buchinhalte mit Schwerpunkt #Wirtschaft #Mittelstand:
#Strategie im #KI-Zeitalter – #Erfolgsfaktoren für #Führungskräfte auf dem Prüfstand
https://buchshop.bod.de/strategie-im-ki-zeitalter-joerg-becker-9783758339707
Quantitäten und Qualitäten einer #Wirtschaftsanalyse mit KI-Dialogen – #Executive #Coaching mit #Rechenmodellen
#Kreativwirtschaft und #Wirtschaftsstandort im KI-Gespräch – #Analysen, #Fallbeispiele, #Handlungsempfehlungen
#Gründen im KI-Gespräch – Skizzen einer #Innovationsgesellschaft
https://buchshop.bod.de/gruenden-im-ki-gespraech-joerg-becker-9783769304039
Standorträtsel

Wo Wirtschaft auf Standort trifft. Was macht einen Standort stark? Wer entscheidet über seine Zukunft? Und was, wenn plötzlich alles auf dem Spiel steht? Im spannenden „Standorträtsel“ treffen strategische Überlegungen, politische Machtspiele und persönliche Verstrickungen aufeinander.
Hanau – Stadt mit Geschichte, Stadt mit Zukunft. Ob alte Industriestandorte, neue Innovationszentren oder kulturelle Brüche: Die Stadt wird zum Symbol für viele Orte auf der Welt, an denen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander ringen. „Ohne gestern gibt es kein heute.“ In „Standorträtsel“ verschmelzen Rückblicke in die Geschichte mit aktuellen Herausforderungen und einem Blick auf das, was morgen möglich sein könnte.– voller Chancen, Risiken und Überraschungen.
Wirtschaftskrimi trifft Standortstrategie und Politik. Es geht nicht nur um Zahlen und Bilanzen – sondern um Macht, Entscheidungen, Chancen und Geheimnisse rund um weltweite und lokale Standorte. Wer sich für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalplanung oder politische Entscheidungsprozesse interessiert, findet hier fundierte, unterhaltsam verpackte Impulse und Denkanstöße. „Standorträtsel“ richtet sich an alle, die Standort neu denken wollen, die wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen – und verändern – wollen.

Business Intelligence = Die richtigen Dinge tun und die Dinge richtig tun.
Business Intelligence-Informationen sind die Trüffel der Geschäftswelt: gut versteckt und sehr wertvoll. Mit einem Business Intelligence-Konzept geht man den Weg vom "einfachen" Reporting hin zum analytischen Wissenssystem.
Digitalisierung verändert unsere Welt – Zeit ist keine Ressource, von der wir zu wenig haben, sondern von der wir uns zu wenig nehmen
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=10&q=J%C3%B6rg+Becker
Ein sich selbst organisierendes Netz wirkt als Verstärker ohnehin bereits vorherrschender (lautstarker) Meinungsträger: Abweichendes oder Kritisches könnte im Schwarm der Gleichdenkenden eher weniger Gehör finden.
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap:

Lohn der Schule
Direkt zum Buchshop:
https://www.bod.de/buchshop/lohn-der-schule-joerg-becker-9783739222967
Durch welche Ursachen wurde das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppelt? Was führte zur Dematerialisierung? Was führte zu der Einsicht, dass unser Planet endlich ist und daher die reale Gefahr besteht, dass seine Rohstoffe und Naturschätze erschöpfen werden – vor allem, wenn Menschen auch in Zukunft immer zahlreicher und gleichzeitig immer wohlhabender werden wollen? Eine tragende Säule ist die Verbindung von Technologie und Kapitalismus. Eine weitere Säule ist die zunehmende Ausschöpfung von Intellektuellem Kapital, dem einzigen Rohstoff, der sich durch Gebrauch vermehren lässt. Ein umfassendes Wissensmanagement trägt dazu bei, Menschen zu informieren, damit sie sich bei ihren Entscheidungen von den besten verfügbaren Erkenntnissen leiten lassen.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
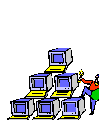
In regelmässigen Abständen werden von Jörg Becker zu Themen "Business Intelligence Wissensbilanz" Whitepaper verfasst
Angesichts eines zunehmend komplexer und turbulenter agierenden Wettbewerbsumfeldes ist die Gültigkeitsdauer einst als langfristig eingestufter Strategien rapide abgeschmolzen. In Branchen mit hohen Veränderungsgeschwindigkeiten dürfte sich die „Halbwertzeit“ von Strategien mittlerweile stark verkürzt haben.
J. Becker Denkstudio - Amazon OnlineShop
Die Zukunft sieht so aus: Texte reduzieren sich auf ein vertiefendes Angebot für eine Minderheit, grafisch aufbereitete Kurzinformationen dominieren, gute Texte und Meinungsbeiträge werden nur noch von einer kleinen Minderheit gelesen, die Masse liest im Internet nur noch Überschriften und Kurzinformationen, den Informationsfluss bestimmen Bildergalerien und Kurzvideos. D.h.: Technik beeinflusst die Modalitäten des Entstehens von Wissen. Der Wandel von Wissen verändert die uns umgebende Welt einschließlich Reaktionen des Bewusstseins. Elektronische Technologien verändern traditionelle Denkstrukturen.
https://www.bod.de/buchshop/wissensintensives-neudenken-joerg-becker-9783754374597
direkt zur Region:
https://www.rheinmaingeschichten.de/
direkt zum Regionalmarketing:
https://www.derstandortbeobachter.de/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
J. Becker Denkstudio - Wir wissen mehr als wir je wussten
Und wenn wir etwas nicht wissen, glauben wir, dass wir die Antwort bestimmt im Internet finden werden. Trotzdem aber werden wir das Gefühl nicht los, dass immer weniger Menschen noch verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Täglich erleben wir dieses kognitive Paradox: je mehr Informationen wir haben desto weniger verstehen wir. Dieses Problem stellt sich nicht nur in alltäglichen Lebenssituationen, sondern ebenso für intellektuelle Problemstellungen und Analysen. Das allgemeine Unbehagen betrifft grundsätzlich die Autonomie und Handlungsfähigkeit des Menschen: man will die gefühlte Ohnmacht mit immer mehr Wissen bekämpfen, die Dunkelheit mit Licht. Wobei Dunkelheit durchaus kein Synonym für Unwissen sein muss. „Wenn das Wissen, die totale Transparenz, die Durchschaubarkeit der Welt ist“, kann die Dunkelheit vielleicht auch ein Ort der Freiheit sein.
Es gilt Murphys Gesetz von der Böswilligkeit des Zufalls: nicht entscheiden heißt, den Zufall entscheiden zu lassen. Und der ist meist nicht kreativ, aber oft missgünstig. Der Zufall mag Entscheidungen abnehmen, aber die Folgen gehen immer ganz zu Lasten des Nicht-Entscheiders.
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz

















































