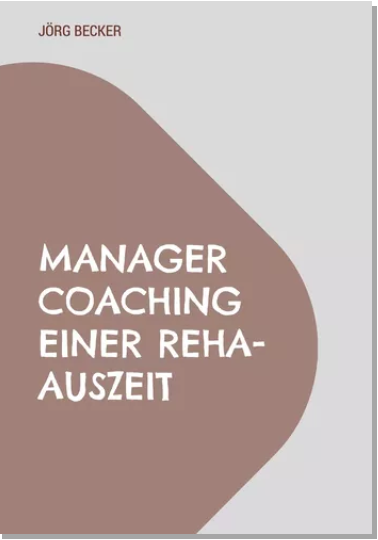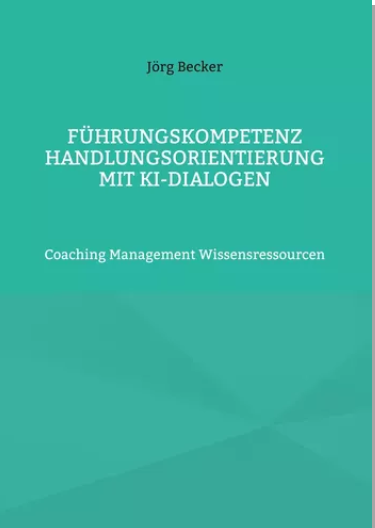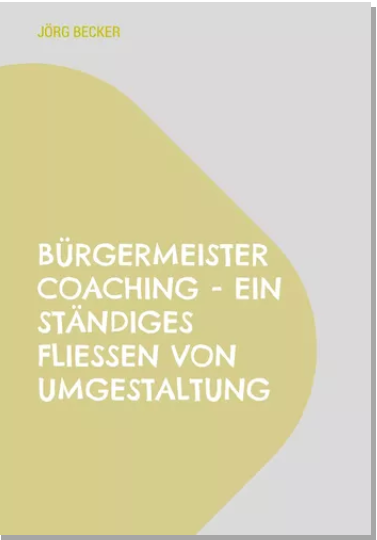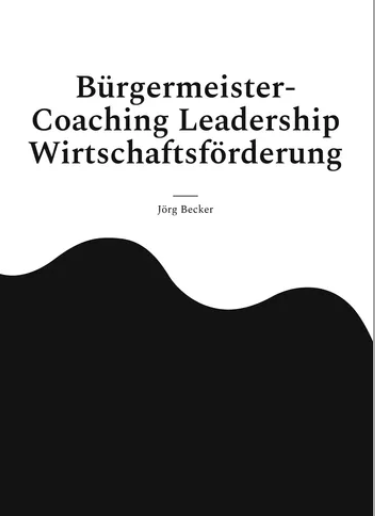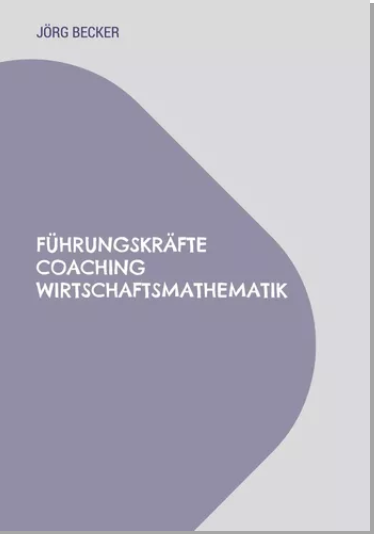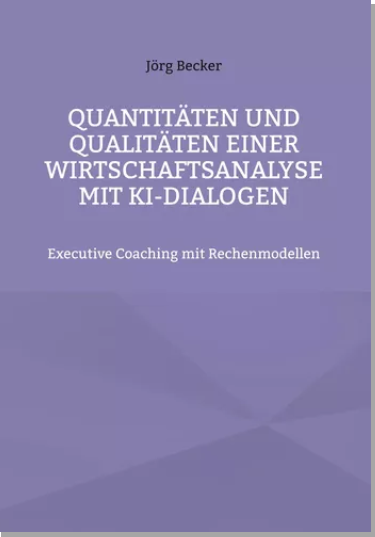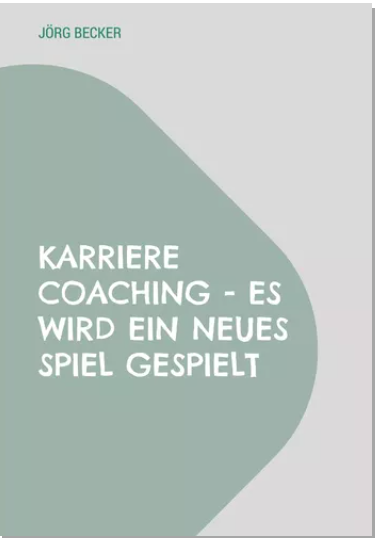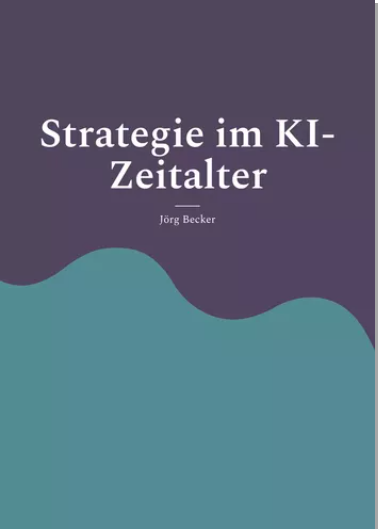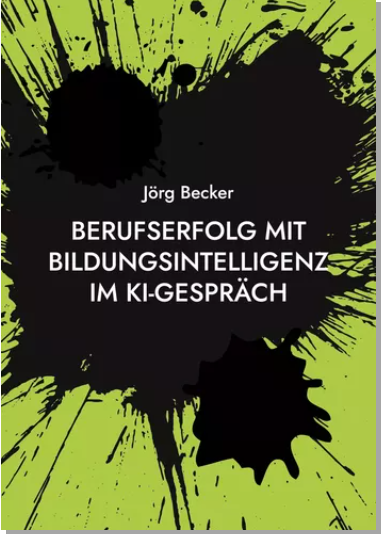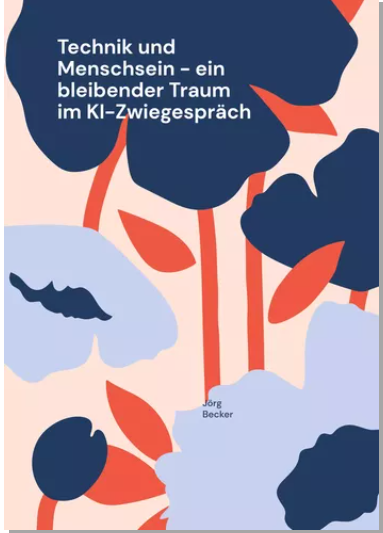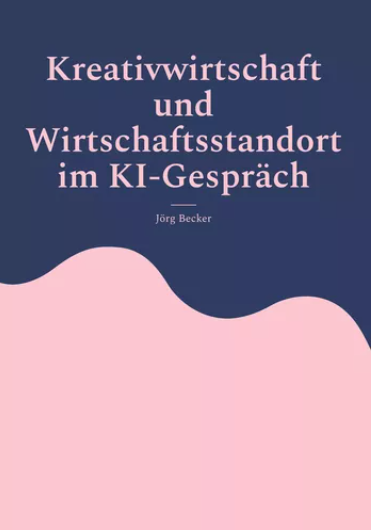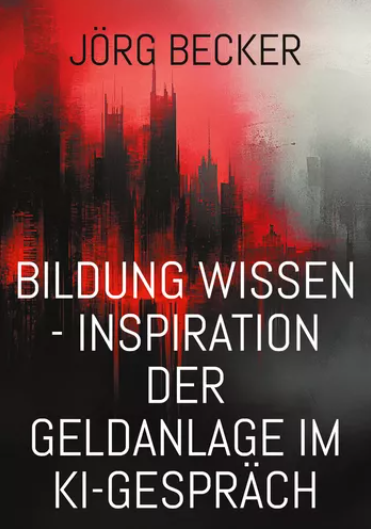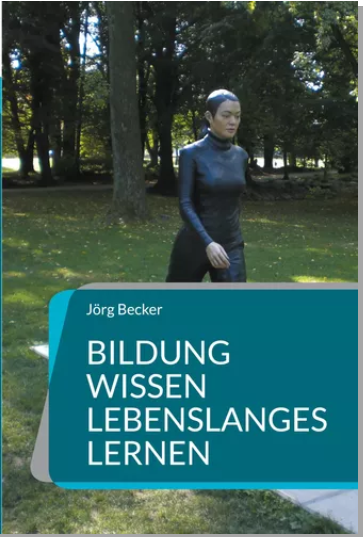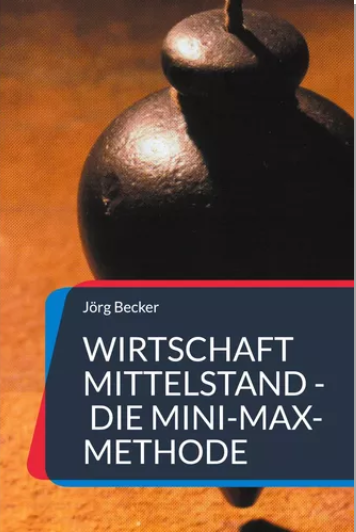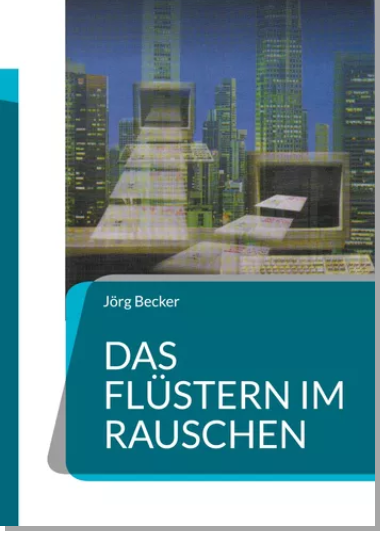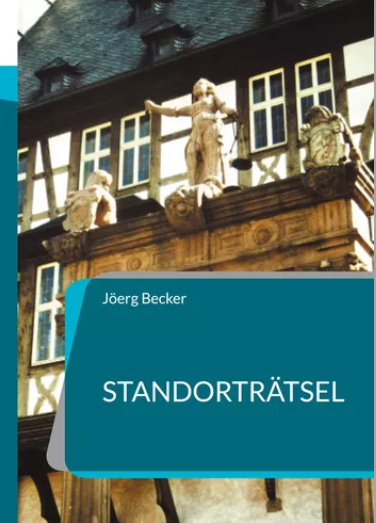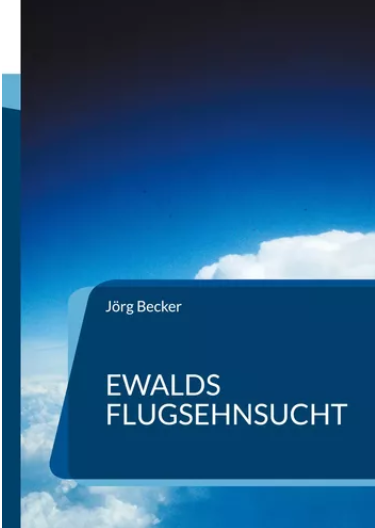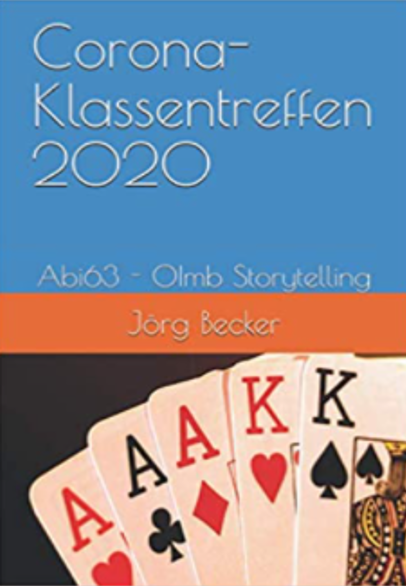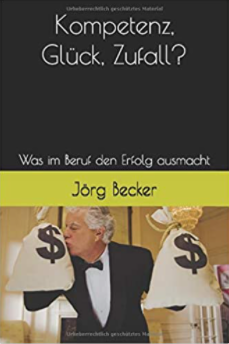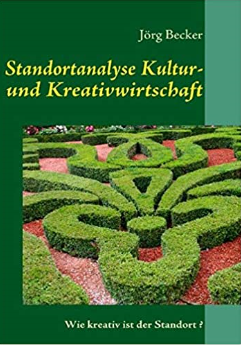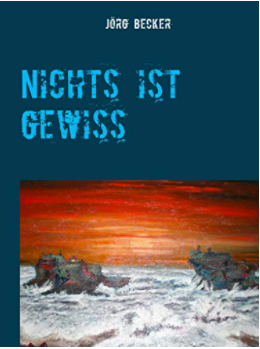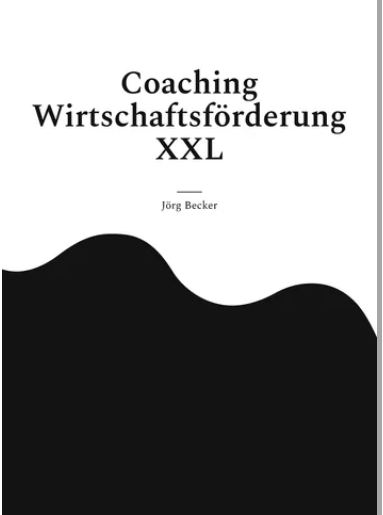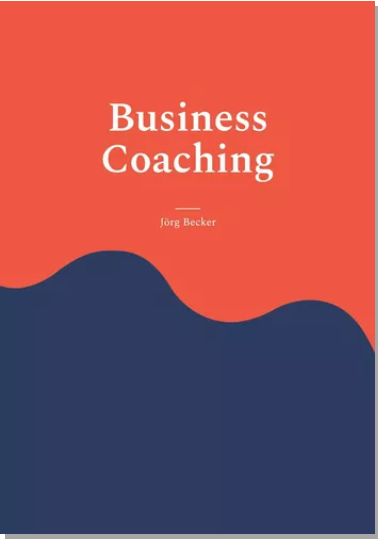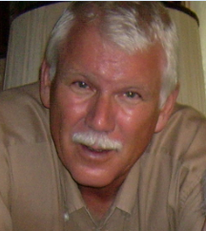Eine erfolgreiche Standortbilanzierung – also die Bewertung und Auswahl eines Standorts z. B. für ein Unternehmen, eine Institution oder ein Projekt – erfordert bestimmte „Fitness-Faktoren“, also Voraussetzungen, die stimmen müssen. Diese betreffen sowohl methodische Kompetenz als auch inhaltliche Klarheit. Zum Beispiel:
Klare Zieldefinition
- Was soll mit der Standortbilanzierung erreicht werden?
-
- Auswahl eines neuen Standorts?
- Bewertung bestehender Standorte?
- Optimierung eines Netzwerks?
- Ziele müssen präzise, messbar und realistisch sein.
Checkliste
Zielklarheit
- Was ist der Hauptzweck der Standortbilanz?
(z. B. Standortbewertung, Investitionsentscheidung, Nachhaltigkeitsanalyse, strategische Planung) - Welche Fragen soll die Standortbilanz beantworten?
Zielgruppenbestimmung
- Für wen wird die Standortbilanz erstellt?
(z. B. Geschäftsleitung, Investoren, Behörden, Öffentlichkeit, interne Abteilungen) - Welche Informationsbedarfe haben diese Zielgruppen?
Bewertungsperspektive
- Aus welcher Perspektive erfolgt die Bilanzierung?
(z. B. ökonomisch, ökologisch, sozial, ganzheitlich) - Gibt es spezielle Schwerpunkte (z. B. CO₂-Bilanz, Standortattraktivität, Infrastrukturverfügbarkeit)?
Bilanzierungszeitraum
- Für welchen Zeitraum soll die Standortbilanz erstellt werden?
(z. B. aktuelles Jahr, mehrjährige Entwicklung, Zukunftsprojektion) - Gibt es Vergleichszeiträume oder Benchmark-Standorte?
Standortbezug
- Um welchen Standort (oder welche Standorte) geht es konkret?
- Werden auch Umfeldfaktoren (z. B. regionale Netzwerke, Zulieferer, Arbeitsmarkt) berücksichtigt?
Datengrundlage & Verfügbarkeit
- Welche Datenquellen stehen zur Verfügung?
(intern, extern, öffentlich, kommerziell) - Wie valide und aktuell sind diese Daten?
Methodik und Kennzahlen
- Welche Kennzahlen oder Indikatoren sollen verwendet werden?
(z. B. Flächenproduktivität, Energieverbrauch, Mitarbeiterzufriedenheit) - Wird eine standardisierte Methode genutzt (z. B. Gemeinwohl-Bilanz, Balanced Scorecard)?
8. Einbindung relevanter Akteure
- Welche internen oder externen Stakeholder sollten in die Zieldefinition einbezogen werden?
- Gibt es Beteiligungsformate (z. B. Workshops, Interviews, Umfragen)?
Verwendung der Ergebnisse
- Wie sollen die Ergebnisse genutzt werden?
(z. B. Entscheidungsgrundlage, Kommunikationsmittel, Optimierungsfahrplan) - Sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden?
Rahmenbedingungen & Ressourcen
- Welche personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen stehen zur Verfügung?
- Gibt es Fristen oder gesetzliche Rahmenbedingungen?
J. #Becker #Denkstudio - #Bürgermeister #Wirtschaftsförderung
#Bürgermeister #Wirtschaftsförderung – #Standortzukunft gestaltbar machen – Inspirierende KI-Gespräche
#Bürgermeister – #Coaching #Leadership #Wirtschaftsförderung – Facettenreiche #Standortwelten
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz