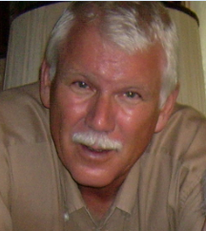Die Ursprungsmaterie aller Standortphänomene ist tief in der Verbindung von Natur, Geschichte, sozialen Strukturen, Politik und Kultur verwurzelt. Diese grundlegenden Faktoren wirken wie ein Set von "DNA-Bausteinen", die das Fundament für aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen bilden. Das Verständnis dieser Ursprünge ist essenziell, um heutige Standortphänomene nicht nur zu erklären,
Es kommt darauf an, diese komplexen Elementarteile und Energien des Standortes ausfindig zu machen, genau zu lokalisieren, möglichst detailliert quantifizierbar zu machen und die vielfältigen Wirkungs- und Kräftebeziehungen untereinander offenzulegen.
Eine Standortanalyse, die auf einem "Set von DNA-Bausteinen" basiert, verbindet verschiedene methodische Ansätze, um die grundlegenden Faktoren eines Standorts ganzheitlich zu bewerten. Diese Bausteine umfassen geografische, wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Elemente. Ein Methoden-Mix aus bewährten Analysetools ermöglicht eine präzise und praxisnahe Bewertung.
Datenbasierte Analyse (Quantitative Ansätze)
Ziel: Messbare Fakten und Muster identifizieren, die den Standort charakterisieren.
-
SWOT-Analyse:
Bewertung der
Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) des Standorts, basierend auf harten Fakten wie Infrastruktur, Arbeitskosten und
Marktpotenzial.
Praxisbeispiel: Ein Logistikunternehmen bewertet die Nähe zu Autobahnen und die Verfügbarkeit von Fachkräften. -
Geodatenanalyse:
Einsatz von GIS
(Geografischen Informationssystemen), um Standortfaktoren wie Rohstoffvorkommen, Verkehrsanbindung und Bevölkerungsdichte räumlich zu analysieren.
Praxisbeispiel: Einzelhändler nutzen Geodaten, um die Kaufkraft im Einzugsgebiet und die Konkurrenzdichte zu ermitteln. -
Statistische
Clusteranalyse: Identifikation
ähnlicher Regionen oder Standorte anhand von Variablen wie Wirtschaftskraft, Innovationsdichte oder demografischen Trends.
Praxisbeispiel: Ein Technologie-Startup prüft Standorte in Innovationsclustern wie Silicon Valley oder Shenzhen.
Szenarioanalyse (Prognostische Ansätze)
Ziel: Zukünftige Entwicklungen simulieren und deren Einfluss auf den Standort bewerten.
-
Szenarioentwicklung:
Simulation
verschiedener Zukunftsszenarien, z. B. demografischer Wandel, technologische Innovationen oder Klimaveränderungen.
Praxisbeispiel: Ein Produktionsunternehmen modelliert Szenarien für die Energiepreisentwicklung und deren Auswirkungen auf die Standortwahl. -
Risiko- und
Sensitivitätsanalyse: Bewertung der
Anfälligkeit des Standorts gegenüber Risiken wie politischen Instabilitäten, Naturkatastrophen oder Marktschwankungen.
Praxisbeispiel: Eine internationale Firma bewertet die Resilienz von Standorten in Regionen mit hohem Klimarisiko.
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz