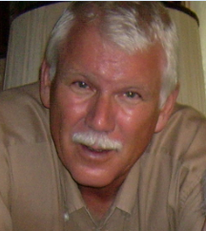SALVE,
Nichts ist mehr so wie es war………………..
Die Kultur- und Kreativwirtschaft birgt ein enormes Innovationspotenzial, das weit über ihre Rolle als Imagefaktor hinausgeht.
Technologische Innovationen durch kreative Anwendungen
Die Kreativwirtschaft agiert häufig als Katalysator für technologische Fortschritte, indem sie neue Technologien in kreativen Kontexten erprobt und weiterentwickelt:
Virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR): Kreative Inhalte wie immersive Theaterstücke, virtuelle Museumsführungen oder interaktive Kunstinstallationen haben VR- und AR-Technologien in den Mainstream geführt. Ein Beispiel ist die Integration von VR bei Museen (z. B. Louvre oder British Museum), die Besuchern digitale Rundgänge ermöglichen.
KI-gestützte Kreativität: Künstliche Intelligenz wird zunehmend zur Unterstützung von Design, Musikkomposition, Literatur und bildender Kunst eingesetzt. Projekte wie AIVA (eine KI, die Musik komponiert) oder DALL-E (KI-generierte Bilder) zeigen das Potenzial der Technologie zur Neudefinition von künstlerischen Prozessen.
3D-Druck in Kunst und Design: Architekten und Designer nutzen 3D-Druckverfahren zur Erschaffung innovativer Formen und Strukturen, die herkömmliche Methoden herausfordern, beispielsweise bei Mode oder Möbel-Design.
Cross-Innovation mit anderen Wirtschaftszweigen
Die Kreativwirtschaft befruchtet andere Branchen, indem sie innovative Ideen und Lösungen liefert:
Medizin und Gesundheit: Künstlerische Ansätze werden bei der Entwicklung von Design für medizinische Geräte oder in der therapeutischen Anwendung von Kunst und Musik eingesetzt, etwa durch Virtual-Reality-Entspannungstools für Patienten.
Automobilindustrie: Kreative Designer und Filmtechniker haben Konzepte wie Head-Up-Displays (ursprünglich aus der Gaming- und Filmindustrie) in die Fahrzeugtechnologie übertragen.
Stadtentwicklung: Architekten und Künstler gestalten urbane Räume, um neue Lebensqualität zu schaffen. Beispiele sind Pop-up-Installationen oder nachhaltige Kunstprojekte, die Stadtbewohner stärker einbinden.
Inovationen in Geschäftsmodellen und digitaler Transformation
Die Kreativwirtschaft hat digitale Plattformen und innovative Geschäftsmodelle hervorgebracht, die neue Formen des Konsums und der Zusammenarbeit ermöglichen:
Streaming-Dienste: Netflix und Spotify sind Beispiele dafür, wie kreative Inhalte durch technologische Innovationen einer breiten Masse zugänglich gemacht werden.
Crowdfunding-Plattformen: Websites wie Kickstarter und Patreon erlauben Kreativschaffenden, unabhängig von traditionellen Finanzierungswegen neue Projekte umzusetzen.
Metaverse und digitale Erlebnisräume: Kunstgalerien und Festivals erschließen virtuelle Welten, in denen Nutzer interaktiv teilnehmen können, wie das digitale Burning Man Festival oder virtuelle Kunstausstellungen in Decentraland.
Innovationsmotor für soziale und kulturelle Transformation
Die Kreativwirtschaft hat auch das Potenzial, gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen:
Gamification und Bildung: Die Entwicklung von Lernspielen und interaktiven Medien trägt zur besseren Wissensvermittlung bei, wie in Projekten von Serious Games für die Wissenschaft oder politischen Bildung.
Nachhaltiges Design und Öko-Innovationen: Kreativschaffende entwickeln Upcycling-Designs, nachhaltige Architektur und ressourcenschonende Konzepte, die neue Standards setzen.
Kulturelle Diversität: Kreativprojekte fördern kulturelle Vielfalt, wie etwa durch inklusive Kunstprojekte oder Musikfestivals, die marginalisierte Stimmen sichtbar machen.
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
Executive Coaching
Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
Die Kultur- und Kreativwirtschaft schafft nicht nur wirtschaftlichen Mehrwert, sondern fungiert als Motor, der Technologien, Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen inspiriert und vorantreibt. Es wäre daher verfehlt, diesen Wirtschaftszweig mit den Augen eines Standortes lediglich als Imagefaktor zu sehen. Zwar ist sie auch das, aber darüber hinaus noch viel mehr: nämlich eine eigenständiges Wirtschaftsfeld mit einem außerordentlich hohen Innovationspotential. Allerdings zählt die Kultur- und Kreativwirtschaft häufig zu den Dingen, die man mit Vorliebe unter der Rubrik „nice to have“ verbucht, sie ansonsten aber lieber am hinteren Ende der Prioritätenfolge einreiht.
Man hat es mit Akteuren aus sehr heterogenen Größenklassen zu tun, für die der oft zitierte Wahlspruch nach Fördernotwendigkeit des Mittelstandes nicht genügend treffgenau wäre. Dabei erweist sich die Kultur- und Kreativwirtschaft als ein äußerst vielschichtiger Branchenkomplex mit einer fast verwirrenden Anzahl unterschiedlicher Facetten. Allen Kreativen gemeinsam ist eine Produktion, die im Wesentlichen aus Prototypen, Einzelfertigung und Kleinserien sowie nicht zuletzt immateriellen Produkten besteht.
Förderangebote sind selten auf die spezifischen Besonderheiten und divergierenden Problemstellungen einzelner Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft ausgerichtet. Zusätzliche Informationsdefizite und Kommunikationsbarrieren tun ein Übriges. Standorte, die nach vorne schauen, kommen vor dem Hintergrund nicht ausgeschöpfter Potentiale trotzdem nicht umhin, eine effektive Förderkulisse zu gestalten.
Für viele Wirtschaftsförderungen zählt der Umgang mit Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht zur alltäglichen Praxis und ist (beiderseitig) vielfach noch mit Vorurteilen und persönlichen Verkrampfungen belastet. An dieser Stelle könnte die hilfreiche Funktion einer Standortbilanz genutzt werden. Damit wird eine jedermann verständliche Kommunikationsplattform angeboten, über die unterschiedlichste Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen und Interessen Kontakte herstellen und nachvollziehbare Entscheidungen vorbereitet werden können
 Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz
Dipl.Kfm. Jörg Becker (DJV)
Publikationen, Analysen, Checks
Standortbilanz und Personalbilanz